Für den fünften Workshop des Forums liegt ein Manuskript zur Architekturanthropologie von Joachim Fischer vor. Außerdem wird ein Manuskript von Caroline Günther zum Konzept des Universal Design diskutiert. Das dritte Manuskript stammt von Karsten Berr. Die Gespräche der letzten Workshops, etwa über Architektur als spezifisches Kommunikationsmedium, werden in Anschauung einiger Bauwerke der Frankfurter Innenstadt vertieft.
Beim vierten Workshop hat Eduard Führ einen Text zur ›Villa Beer‹ in Wien (1931, Entwurf von Josef Frank und Oskar Wlach), ein Gebäude im Stil der internationalen Moderne, zur Diskussion gestellt. Führ gibt seinem Versuch, das Gebäude zu verstehen, einen Rahmen, in dem er auf dem Hintergrund der Vorwürfe der Unmenschlichkeit gegen diese Moderne zwei disparate Verständnisse von Menschlichkeit vorstellt. In diesem Rahmen geht Führ auf die ›Villa Beer‹ zu. Zunächst im wortwörtlichen Sinne. So schildert er seine Erlebnisse bei seiner ersten Annäherung vom Verlassen der U-Bahn bis zum Betreten der Villa; diesesieht er aber als völlig unzureichend für das Verstehen der Villa und als frustrierend an.
Er zeigt dann, wie durch städtebauliche und stadthistorische Kontextualisierung, umfangreiche Quellenarbeit, durch Sehen und durch innere und kritische Dialoge mit sich selbst und andere, das spezifische urbane, funktionale und ästhetische Sosein der Villa verständlich wird. Menschlich sei die ›Villa Beer‹, nicht insofern als sie gemütlich, heimatlich, traditionell ist und Privatheit garantiert, sondern insofern sie die Bewohner, Besucher, Passanten und auch die Fachwissenschaftler zum Sehen und zur tentativen Erkenntnis anregt; wenn diese sich denn auf die Herausforderungen des Bauwerks einlassen.
Die zweite Diskussionsgrundlade des vierten Workshops stammt von Achim Hahn. Er untersucht in seinem Manuskript, wie Architektur von einem lebensweltlich erfahrbaren »Wozuding« zu einem wissenschaftlich erfassbaren Gegenstand werden kann. Dabei betont er, dass theoretische Erkenntnis stets eine Abstraktion von einem solchen »Wozuding« darstellt, die das konkrete Erleben und die praktische Bedeutung von Architektur auf etwas Allgemeines reduziert. Wissenschaftliches Urteilen abstrahiert von affektiver Bedürftigkeit und situativem Umgang mit Dingen und ersetzt lebendige Geschichten durch theoretisch distanzierte Klassifikationen.
Dagegen plädiert Hahn für eine praktische Erkenntnisform, die sich auf konkrete Situationen, Beispiele und lebensweltliches Wissen stützt. Zentral ist insbesondere die Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis, zwischen Subsumtion unter Begriffe und situativem Umgang mit Dingen. Begriffe wie »Zeug« (Heidegger) und »Wozuding« (Schapp) stehen für Dinge, deren Bedeutung sich erst im alltäglichen Gebrauch und in Geschichten entfaltet. Architektur als Lebensmittel offenbart ihr Wesen nicht im formalen Urteil, sondern im wohnenden Umgang. Praktische Erkenntnis zielt auf das Verstehen dieser alltäglichen Bedeutsamkeit – nicht durch Definitionen, sondern durch Beispiele, Konzeptionen und situative Erfahrung. Nur auf diese Weise – so Hahns These – lässt sich das »Sein« der Dinge angemessen erschließen.
»Nach Rom Architekturstudenten zu schicken heißt, sie für ihr ganzes Leben zu ruinieren.« (Le Corbusier 1922). Im Sinne dieses Verdikts hat sich die Architekturmoderne radikal von der klassizistischen Tradition abgewandt, in der die antike Baukunst als Schulung, Folie und Muster galt, indem man ihre Formen, Strukturen und Proportionen formalästhetisch analysierte und nachahmte. Doch gab es bereits in der Antike ein anderes Konzept von Architekturverständnis: das sinnliche Erleben von Raumsequenzen und die Gestaltung von Atmosphären. Vorgeführt wird uns ein solches Verständnis in Bauten wie der Villa Hadriana aber auch in den Villenbriefen des römischen Senators Plinius d. J. (um 100 n. Chr.). Von Architekten wurden Letztere lebhaft diskutiert, bis die Moderne jede Beschäftigung mit der Antike ›untersagte‹.
Der Band Architektur, Atmosphäre, Wahrnehmung versammelt zehn Beiträge, die wieder alle – mehr oder weniger intensiv – als Ausgangsbasis die Villenbriefe nutzen, allerdings nicht, um mit ihnen einen formalästhetischen Zugriff auf die Antike wiederzubeleben, sondern, weil der von Plinius vorgeführte und in der Forschung bis dato vernachlässigte Blick auf die römische Villa unter dem Aspekt einer sequentiellen Sinnlichkeit eine ›Chance für das Bauen heute‹ ist. Im Ergebnis kann man festhalten: Egal ob man Architekturstudenten nach Rom schickt oder nicht – in jedem Fall sollte man sie Plinius lesen lassen.
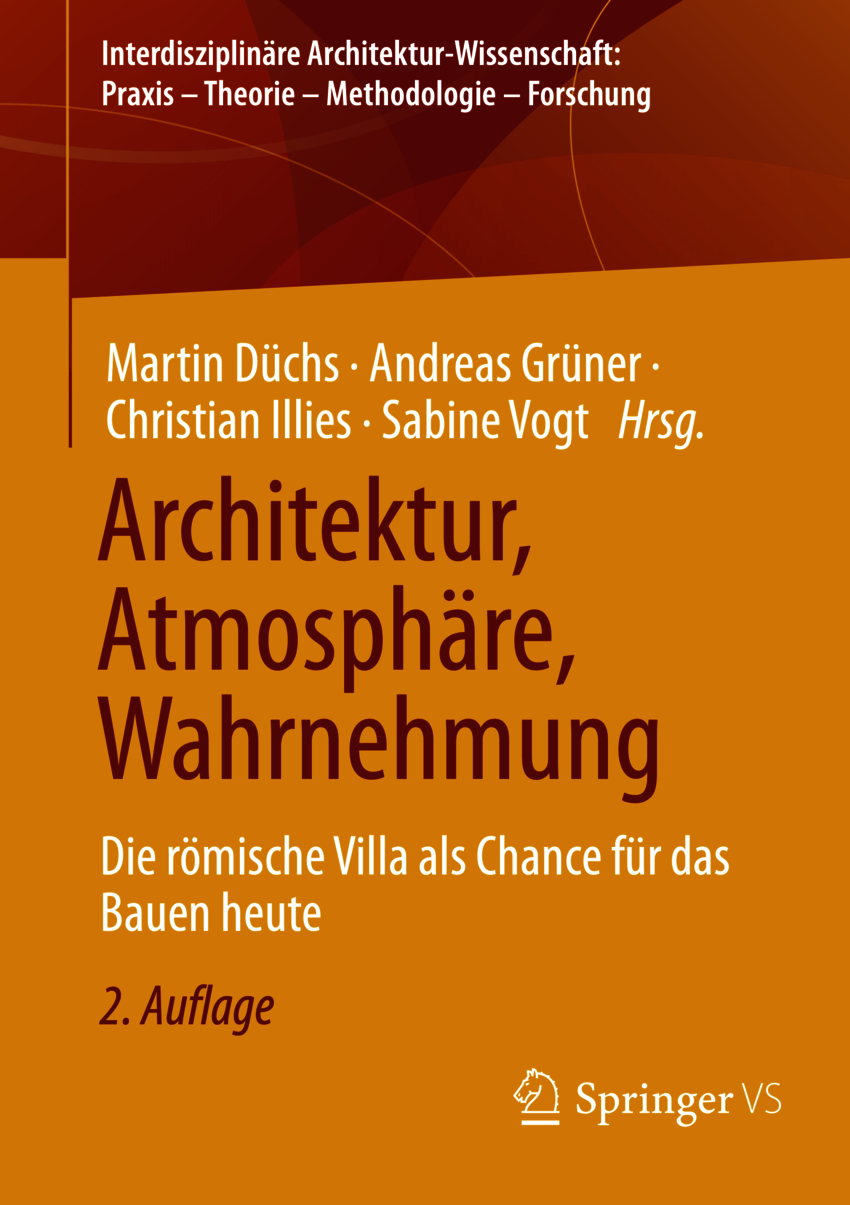
Herausgegeben von Martin Düchs, Andreas Grüner, Christian Illies und Sabine Vogt: Architektur, Atmosphäre, Wahrnehmung. Die römische Villa als Chance für das Bauen heute
Springer VS, Wiesbaden 2023
Joachim Fischer stellt in seinem Manuskript Überlegungen zu einer philosophisch-anthropologisch reflektierten ›Soziologie der Architektur‹ vor. Dabei geht er von der These aus, dass Baukörper untereinander und mit uns auf eine spezifische Weise kommunizieren. Eduard Führ definiert in seinem Manuskript die Architektur als ein eigensinniges Medium, das zwischen Gebrauchs- und Bedeutungswerk changiert. Führ entwickelt seine Überlegung etwa durch die Auseinandersetzung mit Martin Heideggers Der Ursprung des Kunstwerkes (zuerst 1935). Christian Illies zeigt anhand der Heiligkreuz-Mittelschule Coburg, inwiefern Architektur auf menschliche Bedürfnisse Antworten geben kann. Dabei geht es ihm darum, einen Dialog zwischen einer entwicklungspsychologisch genährten philosophischen Anthropologie und der Architekturwahrnehmung in Gang zu bringen. Sebastian Feldhusen, Caroline Günther, Achim Hahn, Olaf Kühne und Petra Lohmann stellen Repliken zu diesen drei Manuskripten vor.
Auf dem ersten Workshop des Forums am 13. und 14. April 2023 an der Technischen Universität Berlin hielt jedes Mitglied einen Vortrag zum Themenkomplex des Forums.
- Ausgehend von Ernst Bloch stellte Achim Hahn die Begriffe »Betroffenheit« und »Bedeutsamkeit« als zwei potentielle Grundbegriffe für den Aufbau einer lebensweltlich orientierten Architekturwissenschaft zur Diskussion. In diesem Zusammenhang wurde die Frage gestellt, welche Relevanz die »Natur« in einer solchen Architekturwissenschaft hat. Um diese Frage zu beantworten, könnte der Ansatz der »Hermeneutischen Gestaltungen« von Georg Misch vielversprechend sein, so Hahn.
- In Anlehnung an die Intention Martin Heideggers, Architektur vom »Wohnen« her zu denken, erfuhr dieser lebensweltliche Ansatz in dem Vortrag von Petra Lohmann eine Vertiefung. In dem Ansatz von Heidegger werden auch die intelligiblen Bedingungen menschlichen Lebens zum Thema gemacht. Heidegger verweist hierbei bekanntlich auf die Rolle der »Erde«, die nur in Einheit mit dem »Himmel« hinreichend gedacht werden kann. An welche Architektur wäre hier zu denken, die diesen Bezug zur Erde mitdenkt? Wie könnte eine solche Architektur interpretiert werden? Methodisch wären diese Fragen nach Lohmann womöglich über den Ansatz eines schwachen Denkens zu bewältigen, wie es etwa von Gianni Vattimo umrissen wurde.
- Christian Illies stellte eine mögliche Heuristik für eine Hermeneutik der Architektonik vor, als deren Grundlage er die Kritik an der strikten Trennung von Subjekt und Objekt definierte. Illies fokussierte auf eine Metaebene, von der aus das reflektierende Subjekt sich das Subjekt-Objekt-Verhältnis in einem »darauf schauenden« Selbstverhältnis erschlösse.
- In der Untersuchung der Geografie von Louisiana (USA) zeigte Olaf Kühne die Potentiale einer neopragmatischen Vorgehensweise für das Verstehen dieses Gebietes und von Landschaft generell. Damit wurde an einem konkreten Beispiel der Bogen geschlagen zu einem Lebensbegriff, der notwendig Natur miteinschließt.
- Dazu passte die Vorstellung des Forschungsvorhabens von Karsten Berr, der nach den wissenschaftstheoretischen Grundlagen der Freiraumplanung in der Bundesrepublik fragte und damit ein bisher vernachlässigtes Forschungsfeld auftat, das die oben genannten lebensweltlichen Bezüge des Menschen vervollständigte.
- Des Weiteren skizzierte Sebastian Feldhusen eine Form der Architekturinterpretation, die anhand von konkreten Orten anschaulich machen möchte, wie die Wirkkraft eines Freiraums oder Bauwerks unser Verhalten beeinflusst.
- Abschließend nahm Eduard Führ den kurzen Text »Über das Lesen von Bauten und Bildern« (1979) von Hans-Georg Gadamer zum Anlass, nach einer »umsichtigen Hermeneutik« zu fragen, die das Erleben eines Bauwerks in dessen geschichtliches Werden und in die Vorurteile der Erlebenden einbindet. Diese Art von Hermeneutik veranschaulichte Führ an der Architektur, die auch für Gadamer Anlass seiner Überlegungen war: die Kathedrale St. Gallen.
Alle Vortragsthemen verbindet, dass das Erleben, Erfahren, Gebrauchen, Nutzen, Verhalten, Wahrnehmen – verkürzt gesagt: die Rezeption – von Architektur stets der Maßstab ist, die eigenen wissenschaftlichen Überlegungen kritisch zu hinterfragen. Auf der Grundlage dieses Workshops wird nun über die zukünftigen Schwerpunktthemen des Forums diskutiert.
Ausgehend von der Konstitution einer »Lebensform Wohnen« vereinigen die Beiträge dieses Buches die Aufgabe, ein überzeugendes und kritisches hermeneutisches Konzept vorzulegen, das wissenschaftstheoretisch fundiert und an Beispielen nachvollziehbar Bedingungen und Möglichkeiten aufzeigt, den komplexen Sitz einer beherbergenden Architektur im Leben der Menschen konstruktiv-methodisch zu erkunden.
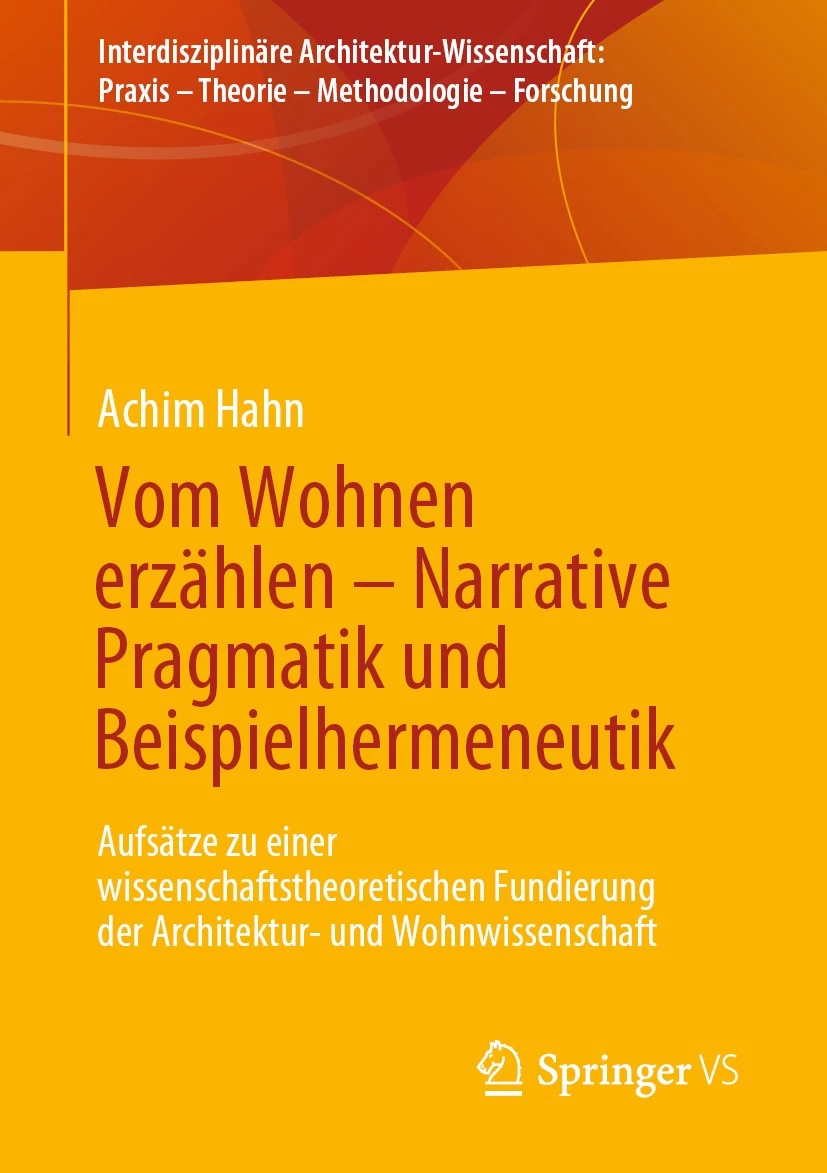
Achim Hahn: Vom Wohnen erzählen – Narrative Pragmatik und Beispielhermeneutik. Aufsätze zu einer wissenschaftstheoretischen Fundierung der Architektur- und Wohnwissenschaft
Springer VS, Wiesbaden 2020
Architektur, anschaulich, gestaltet dinglich und räumlich unsere Lebensumwelt und stellt in dieser genuinen Eigenschaft eine besondere Herausforderung an die Wissenschaft dar. Der Sammelband ist in vier thematische Schwerpunkte gegliedert: Der erste Teil präsentiert philosophische Grundlagen einer interdisziplinären Architekturwissenschaft. Der zweite Teil stellt aus unterschiedlichen disziplinären oder wissenschaftstheoretischen Ansätzen heraus methodologische Grundlagen und Zugriffe bereit. Der dritte Teil beleuchtet das Spannungsverhältnis von Architektur als Disziplin und Praxis zu Architekturtheorie und -wissenschaft. Im vierten Teil werden exemplarisch Theoriebildung und Theorien zu Landschaft, Landschaftsforschung und Landschaftsarchitektur diskutiert.

Bei den versammelten Beiträgen dieses Bandes handelt es sich um die schriftlichen Fassungen von Vorträgen im Rahmen eines von Achim Hahn und Karsten Berr organisierten und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanzierten Rundgesprächs zum Thema Interdisziplinäre Architekturwissenschaft im Juni 2018 an der Technischen Universität Dresden – ergänzt von weiteren Autorinnen und Autoren. Aus diesem Rundgespräch und der Zusammenarbeit an dem Sammelband ist 2022 das Forum Architektonik und Hermeneutik entstanden.
Herausgegeben von Karsten Berr und Achim Hahn: Interdisziplinäre Architektur-Wissenschaft. Eine Einführung
Springer VS, Wiesbaden 2020
Architektur hat eine eigene Relevanz für den Alltag von Menschen. Wenn diese These stimmt, stellt sich die Frage, ob diese Relevanz im Nachdenken über Architektur aktuell hinreichend berücksichtigt wird. Die Teilnehmenden des Workshops Architektur und Leben am 15. und 16. Juli 2022 an der Universität Siegen sahen zumindest zahlreiche Forschungslücken zum gleichnamigen Themenkomplex. Das wurde nach der Vorstellung von Vorträgen deutlich, die zum Beispiel Themen wie Interphänomenalität, Naturverständnisse, Planungsethik, Strukturveränderungen der Lebenswelt behandelten. Neben der Diskussion über die Vorträge wurden auch grundsätzliche Problemstellungen zum Themenkomplex Architektur und Leben behandelt, etwa das Subjekt-Objekt-Problem und Phänomene wie Affektivität, Leiblichkeit, Vorsprachlichkeit.
Die Vorträge und Diskussionen zeigten, dass ein weiterer Austausch zwischen den am Workshop Teilnehmenden wünschenswert ist. Deshalb wurde am 16. Juli 2022 das Forum Architektonik und Hermeneutik gegründet, um einen kontinuierlichen Gesprächsfaden zwischen den Forschenden zu knüpfen. Gründungsmitglieder sind Karsten Berr, Sebastian Feldhusen, Joachim Fischer, Eduard Führ, Caroline Günther, Achim Hahn, Christian Illies, Olaf Kühne und Petra Lohmann. Die Ergebnisse des Workshops werden im Jahr 2023 als Sammelband in der von Eva von Engelberg und Petra Lohmann herausgegebenen Buchreihe Frieder & Henner veröffentlicht. Das Forum hat eine Vorgeschichte: Die Mitglieder des Forums befinden sich seit Jahren in einem fachlichen Austausch. Konturen fand dieser Austausch durch das DFG-Rundgespräch Interdisziplinäre Architekturtheorie, das Karsten Berr und Achim Hahn 2018 initiierten. Das Ergebnis dieses Rundgesprächs wurde 2020 in dem Sammelband Interdisziplinäre Architektur-Wissenschaft veröffentlicht.
